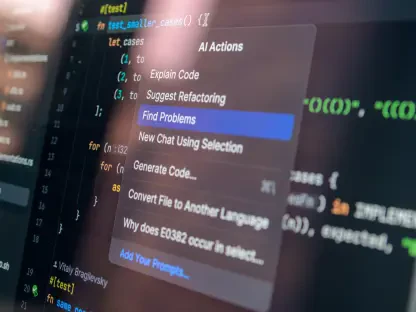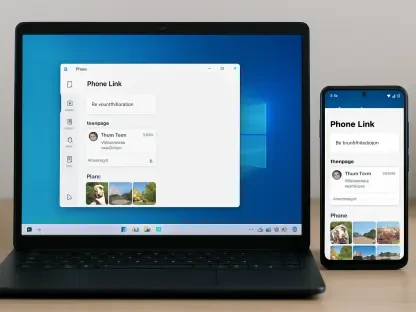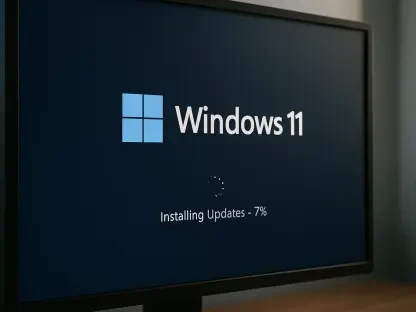Die Alpwirtschaft ist tief in der schweizerischen Kultur und Landwirtschaft verwurzelt und prägt nicht nur die atemberaubende Kulturlandschaft, sondern sichert auch die Pflege der Alpen als unverzichtbaren Bestandteil der nationalen Identität. Doch während die Tradition der Sömmerung weiterhin einen hohen Stellenwert genießt, stehen die Alpbetriebe vor gewaltigen Herausforderungen, die ihre Existenz gefährden. Klimatische Veränderungen, der zunehmende Druck durch Wölfe und Tierkrankheiten setzen der Branche zu und zwingen viele Betriebe, ihre Bewirtschaftung anzupassen oder gar aufzugeben. Gleichzeitig gibt es positive Ansätze, wie die wachsende kulturelle Anerkennung, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nähren. Dieser Artikel beleuchtet die vielschichtigen Probleme, mit denen die Alpwirtschaft aktuell konfrontiert ist, und zeigt auf, welche Entwicklungen und Lösungsansätze es gibt, um die Tradition zu bewahren und dennoch den modernen Anforderungen gerecht zu werden.
Klimatische Herausforderungen und ihre Folgen
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Alpwirtschaft sind nicht zu unterschätzen, denn sie verändern die Bedingungen für die Sömmerung nachhaltig. Während ein schneearmer Winter in der aktuellen Saison eine frühe Schneefreiheit der Weiden ermöglichte und so einen planmäßigen oder sogar vorgezogenen Alpaufzug in den Hochalpen begünstigte, bringen andere Wetterextreme gravierende Probleme mit sich. Besonders in Regionen wie dem Oberwallis führte stärkere Sommertrockenheit zu Futterknappheit, was die Versorgung der Tiere erschwerte. Zudem sorgten regionale Starkniederschläge und Hagel für Schäden an Weiden und Infrastruktur, während Erdrutsche die Zugänglichkeit mancher Standorte einschränkten. Diese unberechenbaren Witterungsverhältnisse zwingen die Älplerinnen und Älpler, ihre Arbeitsweise anzupassen, und verstärken den Druck auf eine ohnehin belastete Branche, die mit sinkenden Erträgen und steigenden Kosten kämpfen muss.
Ein weiteres Problem, das durch den Klimawandel verschärft wird, ist die Anfälligkeit der Tiere für Krankheiten, die unter veränderten Bedingungen schneller Fuß fassen. Krankheiten wie die Blauzungenkrankheit oder Moderhinke treten häufiger auf, da wärmere Temperaturen die Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. Besonders der Betriebswechsel und das Zusammenführen verschiedener Tierbestände während der Sömmerung erhöhen das Risiko von Ansteckungen. Dank einer guten Zusammenarbeit zwischen Tierbesitzern und Behörden konnten zwar viele Vorschriften und Empfehlungen umgesetzt werden, doch bleibt der Umgang mit solchen Herausforderungen aufwendig und kostspielig. Die Notwendigkeit, in präventive Maßnahmen zu investieren, belastet kleinere Betriebe überproportional und führt dazu, dass manche Standorte nicht mehr wirtschaftlich bewirtschaftet werden können, was langfristig die Struktur der Alpwirtschaft verändert.
Wolfsdruck und seine Auswirkungen auf die Betriebe
Der zunehmende Wolfsdruck stellt eine der größten Bedrohungen für die Alpwirtschaft dar und sorgt in vielen Regionen für wachsende Frustration. Trotz der Einführung einer neuen Jagdverordnung, die zur Stabilisierung der Wolfsbestände beitragen soll, bleibt die Zahl der Risse alarmierend hoch. Im Kanton Waadt wurden bis Ende August der laufenden Saison beispielsweise 44 Rinder gerissen, und auch in anderen Gebieten wie dem Tessin, Wallis oder Graubünden treten sogenannte Problemwölfe immer wieder in Erscheinung. Die betroffenen Landwirte stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre Herden zu schützen, während aufwendige Maßnahmen wie Herdenschutz oft an personellen und finanziellen Grenzen stoßen. Diese Situation führt dazu, dass viele Betriebe auf die Haltung von Schafen oder Ziegen verzichten oder schwierige Standorte ganz aufgeben, was die traditionelle Vielfalt der Alpwirtschaft gefährdet.
Hinzu kommt eine wachsende Resignation unter den Betroffenen, die die Lage weiter verschärft. Viele Risse werden nicht mehr gemeldet, da der bürokratische Aufwand und die fehlende Aussicht auf Entschädigung die Motivation mindern. Die Bereitschaft, zeit- und kostenintensive Schutzmaßnahmen umzusetzen, nimmt spürbar ab, wie Expertinnen und Experten warnen. Diese Entwicklung könnte tiefgreifende Folgen haben, da die Anpassung der Bewirtschaftung nicht nur die wirtschaftliche Grundlage vieler Betriebe bedroht, sondern auch die kulturelle Bedeutung der Sömmerung in den Hintergrund drängt. Es wird deutlich, dass ohne nachhaltige Lösungen und eine bessere Unterstützung der betroffenen Regionen die Alpwirtschaft in ihrer bisherigen Form kaum noch aufrechterhalten werden kann, was einen Verlust für die gesamte Gesellschaft bedeuten würde.
Kulturelle Wertschätzung als Hoffnungsträger
Trotz der zahlreichen Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen, die der Alpwirtschaft neuen Auftrieb verleihen könnten. Die Anerkennung der Alpsaison als immaterielles Kulturerbe durch die UNESCO gewinnt zunehmend an Bedeutung und schafft eine Basis, um die gesellschaftliche Wertschätzung für diese Tradition zu stärken. Am 4. Dezember dieses Jahres wird in Bern der Verein „Lebendige Alpsaison“ gegründet, dessen Geschäftsstelle vom Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verband übernommen wird. Dieser Verein bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Kultur, Tourismus sowie kantonalen Ämtern und Forschung zusammen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Unterstützung erfährt die Initiative zudem vom Bundesamt für Kultur und mehreren Kantonen, was die breite gesellschaftliche Relevanz des Themas unterstreicht.
Die Ziele des Vereins sind ambitioniert und zielen darauf ab, die Bevölkerung für die Bedeutung der Sömmerung zu sensibilisieren und die harte Arbeit der Älplerinnen und Älpler stärker ins Bewusstsein zu rücken. Gleichzeitig sollen Lösungen für die aktuellen Herausforderungen erarbeitet und die Vermarktung von Alpprodukten gefördert werden, um die wirtschaftliche Grundlage der Betriebe zu sichern. Diese Bemühungen könnten einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Balance zwischen Tradition und den Anforderungen der modernen Zeit zu finden. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die positiven Impulse ausreichen, um die gravierenden Probleme wie den Klimawandel oder den Wolfsdruck zu bewältigen. Die kulturelle Anerkennung allein wird nicht genügen, wenn nicht auch konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Betriebe umgesetzt werden, die täglich mit den Folgen dieser Bedrohungen kämpfen.
Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Alpwirtschaft nur durch gezielte Maßnahmen und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten überleben konnte. Damals wurden erste Schritte unternommen, um Tierkrankheiten durch strengere Vorschriften einzudämmen, und die Einführung der Jagdverordnung trug dazu bei, den Wolfsdruck zumindest teilweise zu kontrollieren. Diese Erfahrungen verdeutlichen, dass pragmatische Lösungen und staatliche Unterstützung entscheidend sind, um den Fortbestand der Betriebe zu sichern. Ein Blick zurück zeigt, wie wichtig es war, auf die Bedürfnisse der Landwirte einzugehen und gleichzeitig innovative Ansätze zu verfolgen, die Tradition und Moderne verbinden.
Für die kommenden Jahre müssen nun verstärkt Programme entwickelt werden, die den Betrieben finanzielle und praktische Hilfe bieten, sei es durch Subventionen für Herdenschutzmaßnahmen oder durch Investitionen in klimaresiliente Infrastruktur. Ebenso sollte die Forschung gefördert werden, um Krankheiten besser zu verstehen und zu bekämpfen. Eine stärkere Vernetzung zwischen den Regionen könnte zudem den Wissensaustausch erleichtern und bewährte Verfahren verbreiten. Nur durch solche ganzheitlichen Ansätze lässt sich die Alpwirtschaft als unverzichtbarer Bestandteil der schweizerischen Kultur und Wirtschaft erhalten, ohne dass die Betroffenen allein mit den Herausforderungen kämpfen müssen.