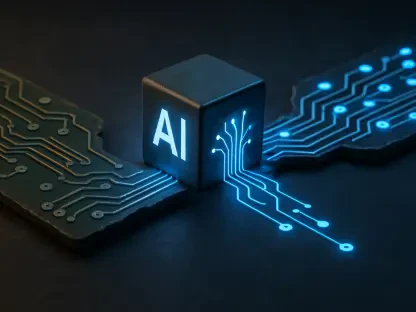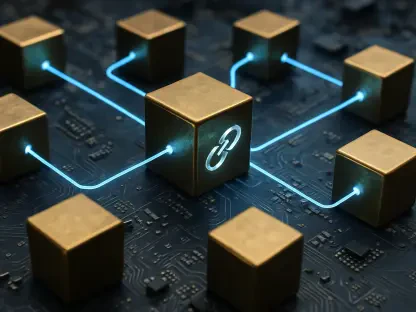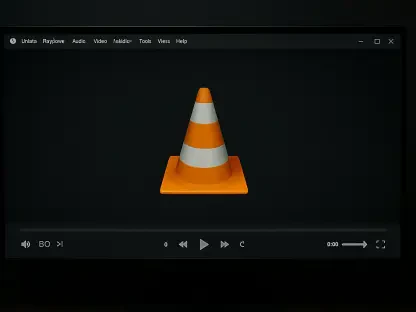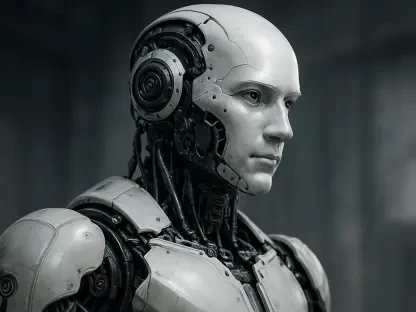Die Digitalisierung im Gesundheitswesen verspricht eine Revolution in der Patientenversorgung und Prozesseffizienz, doch die Realität zeigt ein ernüchterndes Bild voller Hindernisse und Frustrationen, das den Fortschritt erheblich bremst. Während technische Lösungen vorhanden sind, hapert es an der Umsetzung: Fachkräfte fühlen sich überfordert, Systeme werden als Belastung wahrgenommen, und strukturelle Schwächen verhindern nachhaltige Verbesserungen. Ein aktuelles Forschungsprojekt unter der Leitung der Universität Göttingen beleuchtet diese Probleme und zeigt auf, dass es weniger an der Technik selbst, sondern vielmehr an menschlichen und organisatorischen Faktoren liegt. Die Halbzeitbilanz dieses Projekts offenbart alarmierende Defizite, aber auch Ansätze, wie der Stillstand überwunden werden könnte. Dieser Artikel geht den Ursachen für die stockende Transformation auf den Grund und beleuchtet, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Digitalisierung endlich voranzubringen.
Herausforderungen der digitalen Transformation
Digitale Frustration bei Fachkräften
Die Stimmung unter den Beschäftigten im Gesundheitswesen ist von Frustration geprägt, wenn es um digitale Systeme geht. Viele Ärztinnen, Pfleger und Verwaltungskräfte empfinden die eingesetzten Technologien nicht als Erleichterung, sondern als zusätzliche Belastung im ohnehin stressigen Arbeitsalltag. Ein zentraler Grund liegt in der mangelnden Benutzerfreundlichkeit der Software, die oft weder intuitiv noch auf die tatsächlichen Bedürfnisse im Klinik- oder Praxisalltag abgestimmt ist. Hinzu kommen fehlende Schulungen, die den Umgang mit den Systemen erleichtern könnten, sowie unklare Zuständigkeiten, wenn Probleme auftreten. Die Folge ist ein Gefühl der Überforderung, da die Zeit für eine gründliche Einarbeitung schlichtweg fehlt. Diese Situation verdeutlicht, dass die Digitalisierung nicht nur eine Frage der Technik ist, sondern vor allem eine der Begleitung und Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer.
Strukturelle Hürden und fehlende Kompetenzen
Neben der Frustration der Fachkräfte spielen strukturelle Defizite eine entscheidende Rolle beim Stillstand der Digitalisierung. Es mangelt an systematischen Ansätzen, um digitale Kompetenzen gezielt zu fördern, und an klaren Kommunikationswegen, die Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge ermöglichen. Viele Beschäftigte wissen nicht, an wen sie sich bei technischen oder organisatorischen Schwierigkeiten wenden können, was die Akzeptanz digitaler Werkzeuge weiter mindert. Zudem wird oft übersehen, dass digitale Kompetenz nicht nur das Beherrschen von Software bedeutet, sondern auch die Fähigkeit, Technologien kritisch zu hinterfragen und deren Nutzen für die eigene Arbeit zu bewerten. Ohne eine fundierte Basis an Wissen und Reflexionsvermögen bleibt die Digitalisierung oberflächlich und kann ihre Potenziale nicht entfalten. Ein Wandel in der Herangehensweise ist daher dringend notwendig, um nachhaltige Fortschritte zu erzielen.
Lösungsansätze für eine nachhaltige Digitalisierung
Menschenzentrierter Ansatz und Kompetenzentwicklung
Ein vielversprechender Weg aus der digitalen Sackgasse ist ein stärker menschenzentrierter Ansatz, der die Bedürfnisse der Beschäftigten ins Zentrum stellt. Das bedeutet, digitale Systeme nicht isoliert zu entwickeln, sondern die Nutzerinnen und Nutzer frühzeitig in den Prozess einzubinden, um deren Anforderungen und Erfahrungen zu berücksichtigen. Gleichzeitig müssen Kompetenzen systematisch aufgebaut werden, die über reines technisches Wissen hinausgehen. Dazu gehört beispielsweise die Fähigkeit, Daten und Informationen kritisch zu bewerten oder Datenschutzrichtlinien im Arbeitsalltag anzuwenden. Ein differenziertes Kompetenzmodell, wie es im Rahmen des Forschungsprojekts entwickelt wurde, könnte hier als Grundlage dienen, um gezielt Fortbildungen anzubieten. Nur wenn die Beschäftigten sich befähigt fühlen, Technologien sinnvoll zu nutzen, kann die Digitalisierung tatsächlich eine Unterstützung im Berufsalltag werden.
Praxisnahe Entwicklung und Beteiligungsmodelle
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg liegt in der praxisnahen Entwicklung digitaler Anwendungen, die den Versorgungsalltag berücksichtigen. Häufig werden Softwarelösungen primär an regulatorischen Vorgaben ausgerichtet, ohne die realen Herausforderungen in Kliniken oder Praxen ausreichend einzubeziehen. Eine stärkere Einbindung aller relevanten Akteure – von medizinischem Personal bis hin zu Patientengruppen – ist essenziell, um Anwendungen zu schaffen, die tatsächlich einen Mehrwert bieten. Zudem sollten Beteiligungsmodelle etabliert werden, die sicherstellen, dass unterrepräsentierte Gruppen gehört werden. Die zweite Projektphase, die bis Ende 2026 läuft, plant, solche Modelle zu erarbeiten und digitale Kompetenzen messbar zu machen, um den Einfluss auf die Nutzung digitaler Werkzeuge zu analysieren. Dieser Ansatz könnte den Weg ebnen für eine Digitalisierung, die nicht nur technisch, sondern auch menschlich tragfähig ist.
Langfristige Perspektiven und strukturelle Reformen
Abschließend zeigt die Analyse, dass langfristige Perspektiven und strukturelle Reformen unvermeidlich sind, um die Digitalisierung nachhaltig voranzutreiben. Es reicht nicht, punktuell neue Technologien einzuführen; vielmehr müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung ermöglichen. Dazu gehört etwa die Förderung eines reflexiven Umgangs mit Technologie, der es den Beschäftigten erlaubt, aktiv an der Gestaltung digitaler Prozesse mitzuwirken. Ebenso wichtig ist die Bereitstellung ausreichender Ressourcen, sei es in Form von Zeit, finanziellen Mitteln oder qualifiziertem Personal für Schulungen. Die bisherigen Erkenntnisse legen nahe, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz, der Technik, Mensch und Organisation gleichermaßen berücksichtigt, den gewünschten Wandel herbeiführen kann. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob diese Impulse in der Praxis umgesetzt werden konnten und einen echten Fortschritt bewirkten.