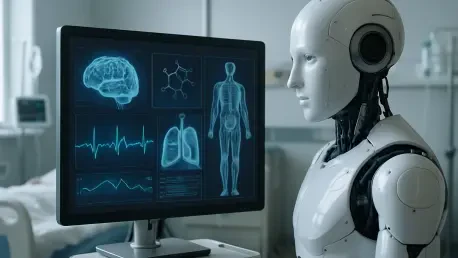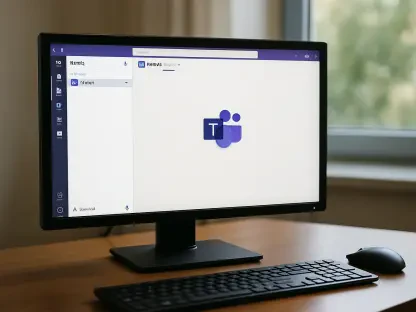Die rasante Entwicklung digitaler Technologien in der Medizin, insbesondere von Künstlicher Intelligenz (KI) und medizinischer Software, steht vor einer großen Herausforderung: den strengen europäischen Verordnungen, die darauf abzielen, die Sicherheit von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Während diese Regelwerke notwendig sind, wächst die Sorge, dass sie Innovationen behindern könnten und somit den Fortschritt in der Gesundheitsversorgung gefährden. Organisationen wie die Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung (TMF), der Medizinische Fakultätentag (MFT) und der Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) schlagen Alarm. In einer gemeinsamen Stellungnahme kritisieren sie, dass die aktuellen Vorgaben der Medizinprodukteverordnung (MDR) und der Verordnung für In-vitro-Diagnostika (IVDR) die Forschung und den Einsatz neuer Technologien unnötig erschweren. Diese Debatte wirft grundlegende Fragen auf: Wie lässt sich ein Gleichgewicht zwischen Patientenschutz und Innovationsförderung finden? Die Diskussion um Anpassungen der Regulierung ist dringlicher denn je, da digitale Lösungen das Potenzial haben, die Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern.
Herausforderungen durch strenge Risikoklassifizierungen
Die Einstufung medizinischer Software, insbesondere solcher, die klinische Entscheidungen unterstützt, in mittlere bis hohe Risikoklassen gemäß der MDR sorgt für erheblichen Unmut. Viele Anwendungen, die lediglich indirekt auf Behandlungsentscheidungen einwirken oder deren Ergebnisse leicht überprüfbar sind, werden genauso streng reguliert wie Systeme, die unmittelbar in lebenswichtige Prozesse eingreifen. Diese pauschale Herangehensweise führt zu einer übermäßigen bürokratischen Belastung, die den Entwicklungsprozess verzögert und die Kosten in die Höhe treibt. Expertinnen und Experten bemängeln, dass der tatsächliche Nutzungskontext und der spezifische Zweck der Software in der aktuellen Regulierung nicht ausreichend berücksichtigt werden. Eine differenziertere Betrachtung könnte hier Abhilfe schaffen, indem niedrigrisiko-Anwendungen von unnötigen Hürden befreit werden, während gleichzeitig die Sicherheit bei hochriskanten Systemen gewährleistet bleibt. Die Forderung nach praxisnahen Anpassungen in der Risikoklassifizierung und den Vorgaben für klinische Studien wird daher immer lauter.
Ein weiterer Aspekt der Kritik betrifft die Auswirkungen dieser strengen Vorgaben auf kleinere Entwicklerteams und akademische Einrichtungen. Für Universitätskliniken und Forschungsinstitute, die oft maßgeblich an der Entwicklung innovativer Software beteiligt sind, erweisen sich die aktuellen Anforderungen als schwer zu erfüllen. Die hohen Kosten und der zeitliche Aufwand für die Zulassung können dazu führen, dass vielversprechende Projekte gar nicht erst realisiert werden. Dies betrifft insbesondere Anwendungen mit geringem Risiko, deren Nutzen für die Patientenversorgung unbestritten ist. Eine Sprecherin der TMF-Arbeitsgruppe für medizinische Software betont, dass eine Reduktion der Bürokratie dringend notwendig sei, um den Innovationsgeist nicht zu ersticken. Ohne solche Anpassungen besteht die Gefahr, dass Europa im internationalen Wettbewerb um digitale Gesundheitslösungen zurückfällt und wertvolle Entwicklungen auf der Strecke bleiben.
Forderung nach flexibleren Regelungen für die Forschung
Die Universitätsmedizin spielt eine zentrale Rolle als Treiber digitaler Innovationen, doch die aktuellen Verordnungen behindern diesen Prozess erheblich. Vertreterinnen und Vertreter der TMF und des MFT fordern klare Regelungen zur Eigenherstellung von Software an Universitätskliniken sowie deren Nutzung in gemeinschaftlichen Forschungsprojekten. Ebenso wird die Möglichkeit gefordert, Eigenentwicklungen als Open-Source-Software zu veröffentlichen, um den Wissensaustausch zu fördern. Ein geschützter Raum für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien in kontrollierter Umgebung könnte den Reifeprozess solcher Systeme unterstützen. Derzeit fehlt es jedoch an einem rechtlichen Rahmen, der solche Experimentierfelder ermöglicht, ohne die Sicherheit der Patientinnen und Patienten zu gefährden. Die Forderung nach einer besseren Harmonisierung der MDR und IVDR mit anderen europäischen Gesetzen und technischen Standards zielt darauf ab, Innovationshemmnisse zu beseitigen und die Forschung zu stärken.
Zusätzlich wird kritisiert, dass die Verordnungen die Balance zwischen Patientenschutz und Innovationsförderung nicht ausreichend berücksichtigen. Während der Schutz der Patientinnen und Patienten oberste Priorität hat, darf dies nicht dazu führen, dass die Entwicklung neuer Technologien zum Stillstand kommt. Die Universitätsmedizin benötigt Flexibilität, um digitale Lösungen und KI-Systeme zu testen und weiterzuentwickeln, bevor sie in den klinischen Alltag integriert werden. Eine überarbeitete Regulierung könnte hier den entscheidenden Unterschied machen, indem sie klare Vorgaben für niedrigrisiko-Anwendungen schafft und gleichzeitig die Sicherheit bei kritischen Systemen gewährleistet. Die Stellungnahme der beteiligten Organisationen, die im Rahmen eines vom Bundesministerium geförderten Projekts entstand, unterstreicht die Dringlichkeit dieser Anpassungen. Nur so kann das Potenzial digitaler Technologien in der Medizin voll ausgeschöpft werden, ohne Kompromisse bei der Qualität der Versorgung einzugehen.
Lösungsansätze für eine ausgewogene Zukunft
Die Diskussion um die Regulierung von KI und Software in der Medizin hat gezeigt, dass eine Überarbeitung der MDR und IVDR unvermeidlich erscheint. Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, eine differenziertere Risikoklassifizierung einzuführen, die den tatsächlichen Einfluss der Anwendungen auf klinische Entscheidungen berücksichtigt. Gleichzeitig wurde angeregt, bürokratische Hürden für Systeme mit geringem Risiko abzubauen, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Ein wichtiger Schritt nach vorn wäre die Schaffung klarer Vorgaben für die Eigenentwicklung und den Einsatz von Software in der Universitätsmedizin. Solche Maßnahmen könnten sicherstellen, dass Innovationen nicht länger durch übermäßige Regulierung blockiert werden, während der Schutz der Patientinnen und Patienten gewährleistet bleibt. Die Debatte hat den Weg für konstruktive Lösungen geebnet, die in den kommenden Jahren weiterverfolgt werden sollten.
Ein zukunftsweisender Ansatz könnte darin liegen, verstärkt auf internationale Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Praktiken zu setzen. Durch eine engere Abstimmung mit anderen Ländern und Regionen könnten Standards entwickelt werden, die sowohl Sicherheit als auch Innovationsfreiheit vereinen. Zudem sollte die Politik in den Dialog mit Forschungseinrichtungen und Kliniken treten, um praxisnahe Regelungen zu erarbeiten, die den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden. Die Einbindung von Expertinnen und Experten aus der Medizininformatik in diesen Prozess wäre essenziell, um realistische und umsetzbare Vorschläge zu formulieren. Nur durch einen solchen ganzheitlichen Ansatz lässt sich gewährleisten, dass die digitale Transformation im Gesundheitswesen nicht ins Stocken gerät, sondern weiter an Dynamik gewinnt. Die kommenden Jahre bieten die Chance, einen ausgewogenen Rahmen zu schaffen, der den Fortschritt fördert und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einhält.