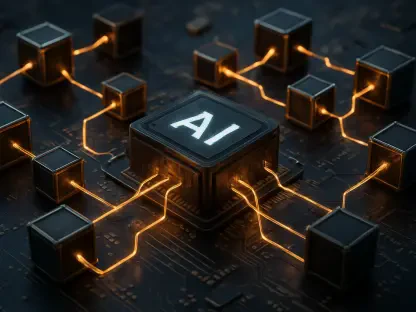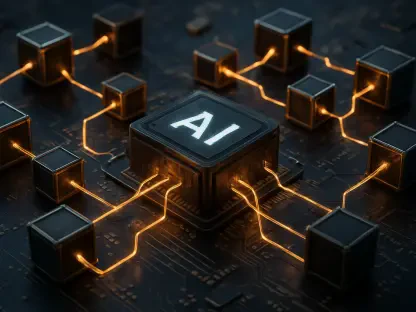In einer Welt, die zunehmend von der Digitalisierung und dem leichten Zugang zu Informationen geprägt ist, wird der Ruf nach Datenschutzmaßnahmen immer lauter, insbesondere im Kontext historischer Daten. Das Bundesarchiv setzt deshalb auf Programme, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, um personenbezogene Daten während der gesetzlich vorgegebenen Schutzfrist zu anonymisieren. Doch dieser technologisch fortschrittliche Ansatz bringt erhebliche praktische Probleme mit sich.
Herausforderungen und Kritik
Übermäßige Anonymisierung durch KI
Forschende und Historiker äußern vehemente Kritik an der umfangreichen Anonymisierung durch die KI des Bundesarchivs. Ihre Hauptbefürchtung ist, dass entscheidende Dokumente durch die exzessive Schwärzung unauffindbar werden. Dies betrifft nicht nur die Namen von Privatpersonen, sondern erstreckt sich auch auf öffentliche Persönlichkeiten wie Präsidenten und Diplomaten. Diese Schlüsselakteure der Zeitgeschichte zu verschweigen, erschwert die wissenschaftliche Forschung erheblich.
Sacha Zala, Geschichtsprofessor und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte, betont, dass KI-gesteuerte Anonymisierungsprozesse über das gesetzlich Erforderliche hinausgehen. Dies führt dazu, dass selbst die Namen von Botschaftern und Staatssekretären unkenntlich gemacht werden. Solch eine umfassende Datenlöschung stellt ein Hindernis für Historiker dar, die versuchen, die politische Geschichte und die diplomatischen Beziehungen einer Epoche zu untersuchen und zu dokumentieren.
Das Google-Paradoxon
Ein weiteres bedeutendes Phänomen wird im Artikel als „Google-Paradoxon“ bezeichnet. Es verweist auf die paradoxe Situation, dass die leichte Zugänglichkeit von Informationen im Internet gleichzeitig den Ruf nach verstärktem Datenschutz erhöht. Diese Entwicklung lässt sich an den Nutzungszahlen des Bundesarchivs ablesen, die durch die Möglichkeit der Onlinesuche merklich gestiegen sind. Während die Digitalisierung die historische Recherche vereinfacht hat, wächst damit auch die Sorge, dass sensible Daten leichter zugänglich und somit missbräuchlich verwendet werden können.
Ironischerweise führt das Bestreben nach mehr Datenschutz zu einem erschwerten Zugang zu offenen und bereits freigegebenen Informationen. Die Balance zwischen Datenschutz und öffentlichem Interesse bleibt ein komplexes Thema, das sowohl Forschung als auch Archivverwaltung gleichermaßen herausfordert. Wissenschaftler und Datenschutzexperten müssen daher gemeinsam Lösungen erarbeiten, um diese widersprüchlichen Anforderungen zu erfüllen.
Früher und heute: Zugang zu Archiven
Traditioneller und moderner Zugang
In der Vergangenheit hatten Wissenschaftler die Möglichkeit, den gesamten Bestand des Bundesarchivs persönlich zu durchsuchen. Diese direkte und umfassende Zugriffsmöglichkeit ermöglichte detaillierte Recherchen und Entdeckungen. Heutzutage stehen jedoch 1,4 Millionen zusätzliche Akten online zur Verfügung, was zwar den Zugang erweitert, aber auch neue Hindernisse schafft. Die Anonymisierung durch die KI führt dazu, dass viele relevante Informationen in den Suchergebnissen nicht mehr auftauchen.
Historiker beklagen, dass die Online-Suche trotz der enormen Datenmenge unvollständig bleibe. Die fehlende Transparenz, verursacht durch die umfassende Schwärzung, mindert den Zugang zu bedeutenden historischen Daten. Besonders frustrierend ist es für Forscher, wenn wichtige Dokumente unauffindbar bleiben, obwohl sie theoretisch vorhanden sind. Demzufolge fordern sie eine effizientere und präzisere Handhabung der Anonymisierungstechnik.
Rechtliche und technische Veränderungen
Ein weiterer Streitpunkt ist das Fehlen von vor Ort genutzten Computern im Bundesarchiv, die früher zur Recherche verwendet wurden. Diese Veränderung ist auf rechtliche und technische Neuerungen zurückzuführen, die den Zugang und die Arbeitsweise in den Archiven verändert haben. Forschende kritisieren das Fehlen dieser Ressourcen als umständlich und ineffektiv, da die Akten nicht immer unmittelbar auffindbar sind und die Unterstützung durch Fachpersonal unzureichend ist.
Die Digitalisierung und der Einsatz von KI sollten die Arbeit der Historiker eigentlich erleichtern, doch die Praxis zeigt oft das Gegenteil. Die Verfügbarkeit von Daten in digitaler Form sollte eine intuitive und umfassende Suche ermöglichen, doch die Realität sieht oft anders aus. Dieses Missverhältnis zwischen Theorie und Praxis fordert die betroffenen Institutionen dazu auf, ihre technologischen und organisatorischen Prozesse zu überdenken und anzupassen.
Datenschutz und wissenschaftliche Integrität
Sichtweise des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Adrian Lobsiger, sieht den Einsatz von KI als grundsätzlich positiv, warnt jedoch davor, dass die Ergebnisse der Anonymisierung nicht verfälscht werden dürfen. Die Hauptaufgabe der KI sollte darin bestehen, ausschließlich die personenbezogenen Daten zu schützen, die tatsächlich das Potential zum Missbrauch aufweisen. Dabei ist es entscheidend, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Datenschutz und wissenschaftlicher Integrität zu finden.
Lobsiger betont, dass es nicht die Intention sein kann, alle Personendaten ohne Unterschied zu schwärzen. Eine differenzierte und maßvolle Herangehensweise ist notwendig, um einen sinnvollen Forschungskontext zu bewahren. So könnten beispielsweise die Namen von öffentlichen Personen oder historische Zusammenhänge weiterhin zugänglich bleiben, während schützenswerte private Informationen wirksam verborgen werden.
Perspektive der Forschenden
Forschungsexperten wie Sacha Zala weisen auf die Gefahr einer verzerrten Geschichtsschreibung durch fälschlicherweise geschwärzte Akten hin. Eine nicht erfolgreiche Suche könnte den irrtümlichen Eindruck erwecken, dass keine Dokumente zu einer bestimmten Person oder einem Ereignis existieren. Dieser Fehler lässt sich oft nur durch zufällige Entdeckungen korrigieren, was die systematische Forschung wesentlich beeinträchtigt.
Zala zieht aus diesen Mängeln die Schlussfolgerung, dass die künstliche Intelligenz den Zugang zu wesentlichen historischen Informationen behindern kann. Dies könnte dazu führen, dass künftige Generationen eine Lücke in ihrem historischen Wissen haben und somit ein unvollständiges Bild der Vergangenheit bekommen. Dies wäre ein erheblicher Rückschlag für die Geschichtswissenschaft, der es gilt, durch sorgfältige und wohlüberlegte Anpassungen der Anonymisierungspraktiken entgegenzuwirken.
Spezifische Herausforderungen und Zahlen
Anzahl irrtümlich geschwärzter Akten
Die Zahl der irrtümlich geschwärzten Akten im Bundesarchiv beläuft sich derzeit auf Zehntausende. Trotz des nur kleinen einstelligen Prozentsatzes bedeuten diese Zahlen bei einem Datenbestand von 1,4 Millionen bearbeiteten Akten eine beträchtliche Menge an unzugänglichen Informationen. Besondere Betroffenheit zeigen Forschende bei Akten, die wichtige Informationen über bedeutende Persönlichkeiten und Ereignisse der Zeitgeschichte enthalten.
Diese irrtümlichen Schwärzungen belegen, dass die KI-gestützte Anonymisierung noch nicht ausgereift ist und Optimierung benötigt. Auch wenn die Technologien zur Datenbearbeitung fortschrittlich sind, scheinen sie dennoch erhebliche Lücken aufzuweisen. Die verantwortlichen Behörden sind angehalten, diese Fehler zu minimieren und die Qualität der Datenaufbereitung zu verbessern.
Schutzfristen und ihre Auswirkungen
Die festgelegten Schutzfristen für Akten variieren: Während allgemeine Akten nach 30 Jahren freigegeben werden, unterliegen Personendaten einer Schutzfrist von 50 Jahren. Besonders schützenswerte Informationen können sogar unbefristete Sperrfristen haben. Diese Vorgaben dienen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte und sollen Missbrauch verhindern. Doch in Kombination mit einer übermäßigen Anwendung künstlicher Intelligenz schaffen sie anspruchsvolle Bedingungen für die Forschung.
Sensitive Informationen müssen geschützt bleiben, ohne dabei den wissenschaftlichen Fortschritt zu bremsen. Die Balance zwischen dem Schutz personenbezogener Daten und der Zugänglichkeit wichtiger historischer Dokumente stellt eine ständige Herausforderung dar. Es ist deshalb notwendig, die Anonymisierungsprozesse weiter zu verfeinern, um eine gerechte Abwägung zwischen Datenschutz und öffentlichem Interesse zu gewährleisten.
Auf den Schutz personenbezogener Daten achten
In einer Ära, in der die Digitalisierung und der schnelle Zugang zu Informationen immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird der Ruf nach effektiven Datenschutzmaßnahmen zunehmend lauter, besonders wenn es um historische Daten geht. Das Bundesarchiv hat sich dieser Herausforderung gestellt und setzt daher auf innovative Programme, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, um personenbezogene Daten während der gesetzlich festgelegten Schutzfrist zu anonymisieren. Dieser fortschrittliche technologische Ansatz soll sicherstellen, dass sensible Informationen geschützt bleiben und gleichzeitig der Forschung zugänglich gemacht werden können. Doch der Einsatz von KI in diesem Bereich bringt nicht nur Vorteile, sondern auch erhebliche praktische Herausforderungen mit sich. Die Komplexität der Daten und die ständige Weiterentwicklung der Technologie erfordern eine kontinuierliche Anpassung und Optimierung der angewandten Methoden. Dennoch bleibt der Ansatz des Bundesarchivs ein wichtiger Schritt in Richtung eines besseren Datenschutzes in einer digitalisierten Gesellschaft.