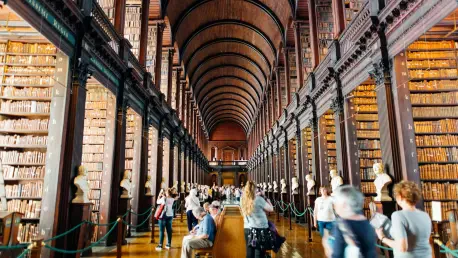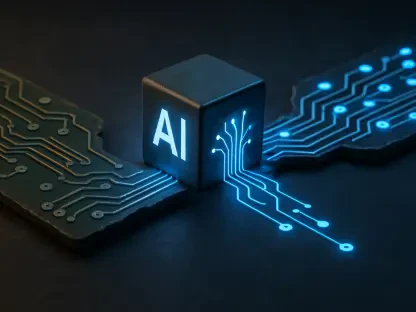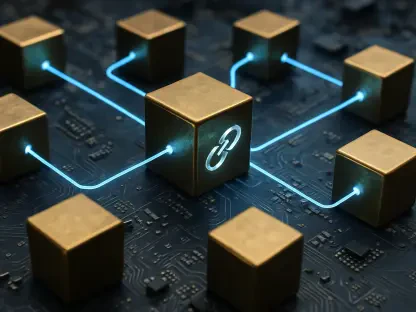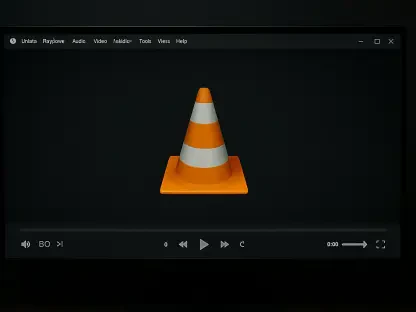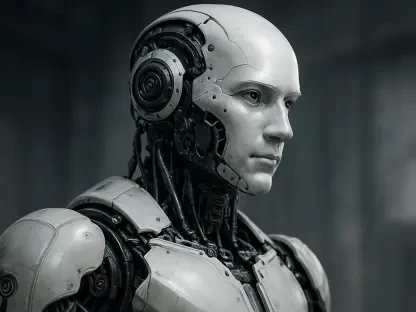In einem Bestreben, die Nachhaltigkeit überregional zu fördern, setzen Hochschulen zunehmend auf Kooperationen und Netzwerke, um gemeinsame Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht den Austausch von Best Practices und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, um umweltfreundliche Projekte und Initiativen zu unterstützen.
In einer Welt, die vor immer komplexeren ökologischen und sozialen Herausforderungen steht, rückt die Nachhaltigkeit in der Hochschulbildung zunehmend in den Fokus, da sie als Schlüssel zur Bewältigung dieser Probleme angesehen wird. Hochschulen aus fünf Bundesländern – Bayern, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen – haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam innovative Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Ein zentrales Ereignis in diesem Bestreben ist die BNE-Projektwerkstatt (Bildung für Nachhaltige Entwicklung), die am 10. Oktober an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) stattfindet. Diese Veranstaltung versammelt Expertinnen und Experten sowie Lehrende und Mitarbeitende, um praxisorientierte Lösungen für die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Hochschullehre zu erarbeiten. Organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen e.V. (DG HochN), bietet die Werkstatt eine Plattform für kreative Methoden wie Design Thinking und fördert die überregionale Vernetzung. Ziel ist es, langfristige Impulse für das gesamte Hochschulsystem zu setzen und Nachhaltigkeit als unverzichtbares Element der Bildung zu etablieren.
Bedeutung der Überregionalen Zusammenarbeit
Ein Thema ohne Grenzen
Überregionale Vernetzung
Die Kooperation von Hochschulen über fünf Bundesländer hinweg unterstreicht eindrucksvoll, wie hoch der Stellenwert von Nachhaltigkeit in der Bildung mittlerweile ist. Institutionen wie die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) und die TU Dresden bringen ihre jeweiligen Stärken und Perspektiven ein, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Diese Zusammenarbeit zeigt, dass die komplexen Anforderungen der Nachhaltigkeit nicht von einzelnen Einrichtungen allein bewältigt werden können. Stattdessen ist ein gemeinsames Vorgehen nötig, das regionale Unterschiede überwindet und auf eine breite Basis an Wissen und Erfahrung zurückgreift. Die BNE-Projektwerkstatt bietet hierfür den idealen Rahmen, um Ideen auszutauschen und innovative Ansätze zu entwickeln, die über die Grenzen der beteiligten Bundesländer hinaus Wirkung entfalten können.
Vielfalt als Stärke
Ein weiterer Aspekt der überregionalen Zusammenarbeit ist die Vielfalt der beteiligten Hochschulen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Expertisen einbringen, wodurch ein breites Spektrum an Perspektiven gewährleistet wird. Während einige Einrichtungen wie die THWS auf angewandte Wissenschaften spezialisiert sind, legen andere wie die TU Dresden Wert auf theoretische Fundierung. Diese Kombination ermöglicht es, Nachhaltigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und ganzheitliche Lösungen zu erarbeiten. Die überregionale Vernetzung schafft zudem die Möglichkeit, Best-Practice-Beispiele zu teilen und voneinander zu lernen. So können erfolgreiche Konzepte, die an einer Hochschule entwickelt wurden, an anderen Standorten angepasst und umgesetzt werden. Diese Dynamik trägt dazu bei, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein lokales, sondern ein bundesweites Thema wird, das die gesamte Hochschullandschaft prägt.
Interne Synergien schaffen
Interdisziplinäre Teams an der THWS
An der THWS wird die Bedeutung der internen Vernetzung durch die Zusammenarbeit verschiedener Hochschulbereiche deutlich, wodurch innovative und nachhaltige Projekte gefördert werden. Interdisziplinäre Teams, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Business School, dem Hochschulservice Nachhaltigkeit und dem Institut für angewandte Logistik, arbeiten Hand in Hand, um die BNE-Projektwerkstatt zum Erfolg zu führen. Diese enge Kooperation ermöglicht es, unterschiedliche Fachperspektiven einzubringen und so umfassende Lösungen zu entwickeln. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte Prof. Dr. Ulrich Müller-Steinfahrt und Prof. Dr. Harald Bolsinger spielen hierbei eine zentrale Rolle, indem sie die inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltung mitgestalten. Diese interne Zusammenarbeit dient als Vorbild für andere Hochschulen, die ähnliche Strukturen aufbauen möchten, um Nachhaltigkeit effektiv zu fördern.
Vorbildfunktion für andere Einrichtungen
Die interne Vernetzung an der THWS zeigt, wie wichtig es ist, Nachhaltigkeit nicht nur als isoliertes Thema zu behandeln, sondern als Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche einer Hochschule betrifft. Von der Verwaltung über die Lehre bis hin zur Forschung – alle Abteilungen tragen dazu bei, dass nachhaltige Konzepte umgesetzt werden. Diese ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht es, Ressourcen effizient zu nutzen und Synergien zu schaffen, die langfristig wirken. Andere Hochschulen könnten von diesem Modell profitieren, indem sie ähnliche Strukturen etablieren, um die interne Zusammenarbeit zu fördern. Die THWS beweist, dass eine enge Vernetzung innerhalb der eigenen Mauern die Basis für eine erfolgreiche überregionale Kooperation bildet und so nachhaltige Bildung auf eine neue Ebene hebt.
Innovative Ansätze für Nachhaltigkeitsbildung
Design Thinking als Methode
Kreativität durch strukturierte Prozesse
Die BNE-Projektwerkstatt setzt auf Design Thinking als zentrale Methode, um innovative Lösungen für die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu entwickeln. Diese Herangehensweise umfasst mehrere Phasen, darunter das Verstehen eines Problems, das Entwickeln von Ideen und das Testen von Prototypen, die in komprimierten Arbeitszyklen bearbeitet werden. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass sie kreative Ansätze mit strukturierten Prozessen verbindet und so praxisnahe Ergebnisse ermöglicht. Die Teilnehmenden werden aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden, wodurch sie nicht nur theoretische Konzepte erarbeiten, sondern diese auch direkt auf ihre Anwendbarkeit prüfen können. Diese interaktive Arbeitsweise fördert den Austausch und schafft Raum für unkonventionelle Ideen, die in der Hochschullehre oft fehlen.
Praxisorientierung im Fokus
Ein weiterer Vorteil von Design Thinking in der BNE-Projektwerkstatt ist die klare Ausrichtung auf praktische Umsetzbarkeit, denn die erarbeiteten Lösungen sollen nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern unmittelbar in der Lehre angewendet werden können. Die Teilnehmenden arbeiten in Gruppen an konkreten Fragestellungen, die sie mit Unterstützung erfahrener Moderatorinnen und Moderatoren bearbeiten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Ergebnisse nicht nur theoretisch fundiert, sondern auch realitätsnah sind. Zudem wird durch die Methode die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen gefördert, da die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Fachbereichen stammen. So entstehen vielseitige Lösungen, die Nachhaltigkeit in der Hochschulbildung auf eine neue Stufe heben und langfristig Wirkung zeigen.
Fokus auf konkrete Herausforderungen
Vielfalt der Design-Herausforderungen
Die Vielfalt der Design-Herausforderungen zeigt sich in den unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen, die an moderne Gestaltung gestellt werden. Es geht nicht nur darum, ästhetisch ansprechende Lösungen zu finden, sondern auch darum, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Diese Aspekte müssen sorgfältig abgewogen werden, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden und gleichzeitig innovative Ansätze zu verfolgen.
Die BNE-Projektwerkstatt konzentriert sich auf vier spezifische „Design Challenges“, die ein breites Spektrum an Themen abdecken, um innovative Ansätze für die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten. Diese reichen vom Einsatz künstlicher Intelligenz in der forschenden Lehre über die Entwicklung einer Online-BNE-Universität für den globalen Süden bis hin zur strukturellen Integration von Nachhaltigkeit in Curricula. Jede dieser Herausforderungen wird von Expertinnen und Experten geleitet, die sicherstellen, dass die erarbeiteten Ansätze sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praxisorientiert sind. Ziel ist es, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur den beteiligten Hochschulen, sondern dem gesamten Bildungssystem zugutekommen. Die Vielfalt der Themen zeigt, wie facettenreich das Feld der Nachhaltigkeitsbildung ist und wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen.
Nachhaltige Impulse setzen
Die Bearbeitung der Design-Challenges in der BNE-Projektwerkstatt soll nachhaltige Impulse für die Hochschulbildung setzen, die über die Veranstaltung hinaus wirken und einen langfristigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bildungssystems leisten. Beispielsweise wird bei der Challenge zur künstlichen Intelligenz untersucht, wie diese Technologie genutzt werden kann, um kritisches Denken zu fördern, ohne soziale und ökologische Zusammenhänge zu vernachlässigen. Eine andere Challenge widmet sich der Frage, wie Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in Studiengänge integriert werden kann, ohne bestehende Inhalte zu verdrängen. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen sollen als Grundlage für langfristige Projekte dienen, die an den beteiligten Hochschulen weiterentwickelt werden. So wird sichergestellt, dass die Ideen nicht nur kurzfristig Aufmerksamkeit erregen, sondern einen bleibenden Einfluss auf die Bildungslandschaft haben.
Globale Perspektiven der Nachhaltigkeit
Bildungsgerechtigkeit weltweit
Zugang für unterversorgte Regionen
Eine der zentralen Herausforderungen der BNE-Projektwerkstatt ist die Entwicklung einer kostengünstigen Online-BNE-Universität, die speziell auf die Bedürfnisse des globalen Südens zugeschnitten ist, um Bildungsgerechtigkeit zu fördern. Unter der Leitung von Prof. Dr. Harald Bolsinger von der THWS und internationalen Partnern wird daran gearbeitet, Studierende in Regionen mit begrenzter technischer Infrastruktur zu erreichen. Ziel ist es, Bildungsangebote zu schaffen, die trotz technischer Hürden zugänglich sind. Dieser Ansatz berücksichtigt die spezifischen Herausforderungen dieser Regionen und setzt auf innovative Lösungen, um den Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen. Die globale Perspektive verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit nicht nur lokal, sondern auch international gedacht werden muss.
Langfristige Wirkung globaler Bildung
Die Schaffung einer Online-BNE-Universität für den globalen Süden könnte langfristig einen tiefgreifenden Einfluss auf die Bildungslandschaft haben und damit den Zugang zu Wissen in unterversorgten Regionen erheblich verbessern. Durch die Bereitstellung von Bildungsressourcen wird nicht nur der Zugang zu Wissen erleichtert, sondern auch die Grundlage für nachhaltige Entwicklung vor Ort gelegt. Die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie der Christ University in Indien stellt sicher, dass die entwickelten Konzepte kulturell sensibel und an die lokalen Bedürfnisse angepasst sind. Dieser globale Ansatz zeigt, wie wichtig es ist, Nachhaltigkeit in einem größeren Kontext zu betrachten und Bildung als Werkzeug für weltweite Gerechtigkeit zu nutzen. Die Ergebnisse dieser Herausforderung könnten als Modell für weitere internationale Projekte dienen und so die Reichweite der Nachhaltigkeitsbildung erheblich erweitern.
Internationale Kooperationen
Partnerschaften über Kontinente hinweg
Die Einbindung internationaler Partner wie der Christ University in Indien bereichert die BNE-Projektwerkstatt um wertvolle globale Perspektiven und ermöglicht es, Nachhaltigkeit nicht nur aus einer nationalen, sondern auch aus einer internationalen Sicht zu betrachten. Diese Kooperationen tragen dazu bei, Lösungen zu entwickeln, die universell anwendbar sind, indem sie Institutionen aus verschiedenen kulturellen und wirtschaftlichen Kontexten zusammenbringen. Insbesondere bei der Entwicklung von Bildungsangeboten für den globalen Süden ist diese internationale Expertise von unschätzbarem Wert. Die Partnerschaften fördern den Austausch von Wissen und Erfahrungen und schaffen so eine Grundlage für langfristige gemeinsame Projekte, die die Nachhaltigkeitsbildung weltweit voranbringen.
Globale Netzwerke stärken
Die internationalen Kooperationen, die im Rahmen der BNE-Projektwerkstatt entstehen, sind ein wichtiger Schritt zur Stärkung globaler Netzwerke in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch den Austausch mit Partnern aus verschiedenen Ländern werden nicht nur neue Ideen generiert, sondern auch bestehende Ansätze weiterentwickelt. Diese Netzwerke bieten die Möglichkeit, gemeinsame Forschungsprojekte zu initiieren und Bildungsprogramme zu entwickeln, die über nationale Grenzen hinausgehen. Die Zusammenarbeit zeigt, dass Nachhaltigkeit ein universelles Anliegen ist, das nur durch globale Solidarität und gemeinsame Anstrengungen bewältigt werden kann. Die Ergebnisse dieser Partnerschaften könnten als Vorlage für weitere internationale Initiativen dienen und so die Grundlage für eine weltweite Bewegung hin zu nachhaltiger Bildung schaffen.
Langfristige Impulse für das Hochschulsystem
Nachhaltigkeit als Querschnittsthema
Verankerung in Studiengängen
Die strukturelle Integration von Nachhaltigkeit in Hochschulcurricula ist eine der zentralen Herausforderungen, die in der BNE-Projektwerkstatt bearbeitet werden, um eine nachhaltige Bildung flächendeckend zu verankern. Unter der Leitung von Prof. Dr. Miriam Barnat von der FH Aachen wird daran gearbeitet, Nachhaltigkeit als festen Bestandteil der Ausbildung zu etablieren, ohne andere inhaltliche Schwerpunkte zu beeinträchtigen. Ziel ist es, möglichst viele Studierende zu erreichen und ihnen die Bedeutung nachhaltigen Handelns zu vermitteln. Diese Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, da die Anforderungen in den verschiedenen Fachbereichen stark variieren. Die erarbeiteten Konzepte sollen als Leitlinien dienen, die an unterschiedliche Studiengänge angepasst werden können, um eine breite Wirkung zu erzielen.
Ganzheitliche Bildung fördern
Die Integration von Nachhaltigkeit in Studiengänge geht über die bloße Vermittlung von Fachwissen hinaus und zielt auf eine ganzheitliche Bildung ab, bei der Studierende nicht nur theoretische Inhalte kennenlernen, sondern auch verstehen, wie sie diese in ihrem beruflichen und privaten Leben anwenden können. Die BNE-Projektwerkstatt legt daher besonderen Wert darauf, praxisnahe Ansätze zu entwickeln, die den Studierenden konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Diese Herangehensweise stellt sicher, dass Nachhaltigkeit nicht als abstraktes Konzept wahrgenommen wird, sondern als integraler Bestandteil des Studiums. Langfristig könnte diese Strategie dazu beitragen, eine Generation von Absolventinnen und Absolventen hervorzubringen, die nachhaltiges Denken und Handeln in die Gesellschaft tragen.
Leitfaden für Lehrende
Praktische Unterstützung bieten
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der BNE-Projektwerkstatt ist die Entwicklung eines hochschulübergreifenden BNE-Wegweisers für Lehrende, der unter der Leitung von Christian Einsiedel und Dr. Christoph Harrach von der TH OWL erarbeitet wird. Dieser Leitfaden kombiniert theoretische Grundlagen mit praktischen Tipps, um Lehrenden die Integration von Nachhaltigkeit in ihren Unterricht zu erleichtern und so einen nachhaltigen Beitrag zur Bildung zu leisten. Ziel ist es, eine Orientierungshilfe zu schaffen, die sowohl für erfahrene Dozentinnen und Dozenten als auch für Neueinsteiger geeignet ist. Der Wegweiser soll konkrete Beispiele und Methoden enthalten, die sich leicht in bestehende Lehrpläne einbinden lassen. Diese Unterstützung ist besonders wichtig, da viele Lehrende vor der Herausforderung stehen, Nachhaltigkeit in einem ohnehin dichten Lehrplan unterzubringen.
Langfristige Umsetzung sichern
Die Bedeutung des BNE-Wegweisers liegt nicht nur in der unmittelbaren Unterstützung der Lehrenden, sondern auch in der langfristigen Sicherung der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch die Bereitstellung eines fundierten Leitfadens wird gewährleistet, dass die erarbeiteten Konzepte nicht nur während der Projektwerkstatt relevant sind, sondern auch darüber hinaus angewendet werden können. Die Hochschulen können den Wegweiser als Grundlage nutzen, um eigene Fortbildungsprogramme zu entwickeln und ihre Lehrenden kontinuierlich weiterzubilden. Diese nachhaltige Wirkung ist essenziell, um sicherzustellen, dass das Thema Nachhaltigkeit dauerhaft in der Hochschulbildung verankert bleibt. Die Initiative zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur kurzfristige Lösungen zu finden, sondern langfristige Strukturen zu schaffen, die den Wandel unterstützen.