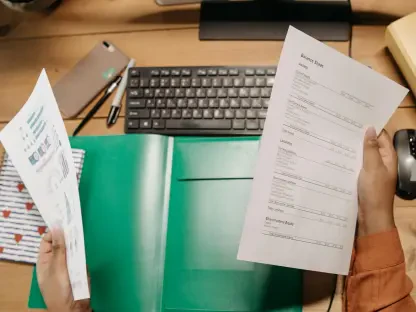In einer Zeit, in der digitale Kommunikation allgegenwärtig ist, stehen deutsche Städte und Gemeinden vor einer grundlegenden Herausforderung, die weit über technische Fragen hinausgeht und tief in das verfassungsrechtliche Gefüge der Bundesrepublik eingreift. Mit dem Ausbau eigener digitaler Kanäle, von professionell gestalteten Stadtportalen über aktive Social-Media-Profile bis hin zu Newslettern, betreten sie ein rechtliches Minenfeld, in dem die Grenzen zwischen notwendiger Bürgerinformation und unzulässiger Konkurrenz zur freien Presse immer mehr verschwimmen. Während die einen in der direkten Kommunikation eine Chance für mehr Transparenz und Bürgernähe sehen, warnen andere vor einer schleichenden Aushöhlung der lokalen Medienvielfalt und einer Verletzung des fundamentalen Prinzips der Staatsferne der Presse. Dieser schwelende Konflikt hat sich mittlerweile zu einem juristischen Pulverfass entwickelt, das die grundlegende Frage aufwirft, wie weit staatliche Öffentlichkeitsarbeit gehen darf, ohne das fragile Gleichgewicht der Gewalten zu gefährden.
Der wachsende Konflikt zwischen Rathaus und Redaktion
Die digitale Offensive der Kommunen
In den letzten Jahren ist ein unübersehbarer Trend zu beobachten: Kommunen rüsten digital massiv auf und etablieren sich zunehmend als eigenständige Medienakteure, die ihre Bürgerinnen und Bürger direkt und ohne den Umweg über klassische Medien erreichen. Eine umfassende Umfrage des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien (VDL) belegt eindrücklich das Ausmaß dieser Entwicklung. Demnach nutzen zahlreiche Städte und Gemeinden täglich Plattformen wie Instagram, Facebook oder YouTube, um nicht nur amtliche Bekanntmachungen zu verbreiten, sondern auch um über lokale Ereignisse zu berichten, das Stadtmarketing zu fördern und ein positives Image zu pflegen. Diese strategische Neuausrichtung der kommunalen Kommunikation ist eine direkte Reaktion auf das veränderte Mediennutzungsverhalten der Bevölkerung, insbesondere jüngerer Zielgruppen, die Informationen primär über digitale und soziale Netzwerke konsumieren. Die Rathäuser sehen darin eine Notwendigkeit, um ihre Informationspflichten in einer digitalisierten Welt effektiv zu erfüllen.
Diese Entwicklung wird angetrieben von dem Wunsch, die Kontrolle über die eigene Darstellung zu behalten und eine direkte, ungefilterte Verbindung zu den Bürgern herzustellen. Eigene Stadtportale werden zu umfassenden Informationszentren ausgebaut, die weit über reine Verwaltungsdienstleistungen hinausgehen und oft auch Veranstaltungskalender, Porträts lokaler Persönlichkeiten oder Berichte über Vereinsprojekte enthalten. Kommunale Newsletter informieren Abonnenten regelmäßig über die neuesten Entwicklungen, während auf Social-Media-Kanälen mit ansprechenden Bildern und Videos um Aufmerksamkeit geworben wird. Diese professionalisierte Form der Öffentlichkeitsarbeit zielt darauf ab, die Kommune als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort zu präsentieren. Doch genau diese journalistische Aufbereitung und die breite thematische Streuung führen zu einem wachsenden Spannungsverhältnis mit den lokalen Medienverlagen, die in diesen Aktivitäten eine direkte Bedrohung ihres eigenen Geschäftsmodells sehen und die grundlegende Frage nach der Rolle des Staates in der Medienlandschaft aufwerfen.
Die Folgen für die lokale Medienlandschaft
Die digitale Kommunikationsoffensive der Kommunen bleibt nicht ohne Konsequenzen und hat sich zu einem ernsthaften Konfliktpunkt entwickelt, der zunehmend vor Gericht ausgetragen wird. Zahlreiche Redaktionen und Verlage betrachten die kommunalen Aktivitäten nicht länger als eine sinnvolle Ergänzung ihrer eigenen Arbeit, sondern als eine direkte und unlautere Konkurrenz. Laut der VDL-Umfrage gibt ein Drittel der Verlage an, dass die digitale Kommunikation ihrer Kommune den eigenen digitalen Vertrieb und die Reichweite ihrer Angebote nachweislich beeinträchtigt. Wenn das städtische Portal tagesaktuell und kostenfrei über Themen berichtet, für die die Lokalzeitung bei ihren Lesern um Abonnements wirbt, entsteht ein wirtschaftlicher Druck, der die Existenzgrundlage der freien Presse untergraben kann. Dieses Phänomen wird als „Mission Creep“ bezeichnet, eine schleichende Ausweitung der staatlichen Tätigkeit in Bereiche, die traditionell dem Journalismus vorbehalten sind.
Über die wirtschaftliche Konkurrenz hinaus äußern viele Medienhäuser auch fundamentale Kritik an der Qualität und Ausrichtung der kommunalen Inhalte. Drei Viertel der befragten Redaktionen beklagen, dass die neuen digitalen Angebote der Kommunen oft weder sachlich noch neutral seien. Statt reiner Information würden häufig Inhalte verbreitet, die einer politischen Selbstdarstellung des Bürgermeisters oder der Verwaltung dienen und den Anschein einer unabhängigen Berichterstattung erwecken, ohne jedoch journalistischen Standards wie einer kritischen Distanz oder der Darstellung verschiedener Perspektiven zu genügen. Diese Vermischung von Information, Werbung und politischer Agenda führt zu einem Vertrauensverlust und erschwert es den Bürgern, zwischen staatlicher Kommunikation und unabhängigem Journalismus zu unterscheiden. Die Folge sind vermehrte juristische Auseinandersetzungen, bei denen Verlage gegen Städte und Gemeinden klagen, da sie einen klaren Verstoß gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Staatsferne der Presse sehen.
Der rechtliche Rahmen Was ist erlaubt
Die Grundlagen der zulässigen Öffentlichkeitsarbeit
Trotz der zunehmenden Konflikte steht außer Frage, dass der Staat und damit auch die Kommunen nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht haben, die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeiten zu informieren. Diese Aufgabe ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Demokratie und dient der Transparenz staatlichen Handelns. Die unstrittige Kernkompetenz der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit liegt in der Verbreitung sachlicher Behördeninformationen, die einen direkten Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben der Kommune haben. Dazu zählen beispielsweise amtliche Bekanntmachungen über neue Satzungen, Informationen zu bevorstehenden oder vergangenen Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse sowie die Veröffentlichung von gefassten Beschlüssen. Ebenso gehören Ausschreibungen für öffentliche Aufträge, Informationen zur Bauleitplanung oder rein organisatorische Hinweise wie geänderte Öffnungszeiten von Ämtern, Termine der Müllabfuhr oder Ankündigungen von Straßensperrungen zu diesem Bereich.
Solange diese Informationen sachlich aufbereitet sind und eindeutig der Erfüllung der Verwaltungsaufgaben dienen, stellen sie kein presseähnliches Konkurrenzangebot dar und sind rechtlich unbedenklich. Die Kommunikation muss dabei stets als staatliches Handeln erkennbar bleiben und darf nicht den Eindruck einer unabhängigen journalistischen Berichterstattung erwecken. Der Fokus liegt klar auf der Vermittlung von Fakten, die für das Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger relevant sind und ihnen die Teilhabe am kommunalen Geschehen ermöglichen. Diese Form der Informationsvermittlung ist nicht nur erlaubt, sondern auch gesellschaftlich erwünscht, da sie die Grundlage für eine informierte Bürgerschaft schafft. Die rechtlichen Probleme beginnen erst dort, wo diese klare Linie überschritten wird und die Kommune beginnt, Inhalte zu produzieren, die über den rein informatorischen Charakter hinausgehen und in den Bereich der allgemeinen Berichterstattung oder Meinungsbildung vordringen.
Digitale Kanäle im rechtlichen Korsett
Die Nutzung moderner digitaler Kanäle wie sozialer Medien oder eigener Stadtportale durch Kommunen ist grundsätzlich zulässig, unterliegt jedoch den gleichen strengen rechtlichen Vorgaben wie klassische Publikationen. Auch hier gilt das Primat der sachlichen Information mit klarem Aufgabenbezug. Beiträge über geänderte Verfahren im Bürgerbüro, Warnhinweise vor Unwettern oder Erläuterungen zu neuen kommunalen Dienstleistungen sind legitime und sinnvolle Anwendungsfälle. Die Gerichte, allen voran der Bundesgerichtshof (BGH), haben jedoch klare Grenzen definiert. In einem wichtigen Urteil wurde entschieden, dass kommunale Internetseiten zwar in einem begrenzten Umfang auch einzelne Elemente enthalten dürfen, die als journalistisch-redaktionell gestaltet bezeichnet werden können, beispielsweise ein Interview mit einem Amtsleiter zur Erläuterung einer neuen Verordnung.
Die entscheidende Bedingung ist jedoch, dass der Gesamteindruck der Webseite oder des Social-Media-Auftritts nicht presseähnlich sein darf. Der amtliche Charakter muss stets klar überwiegen und für den Nutzer auf den ersten Blick erkennbar sein. Ein Stadtportal darf sich nicht zu einer Art lokaler Online-Tageszeitung entwickeln, die systematisch über das gesamte gesellschaftliche Leben berichtet und damit die freie Presse konkurrenziert. Rechtliches Neuland betreten Kommunen insbesondere dann, wenn sie politische Meinungen von Amtsträgern ungefiltert verbreiten, sich aktiv in gesellschaftliche Debatten einmischen oder ihre Inhalte so aufbereiten, dass sie von einem unabhängigen Medienangebot nicht mehr zu unterscheiden sind. In solchen Fällen wird die zulässige Informationstätigkeit überschritten und das verfassungsrechtlich geschützte Verhältnis zwischen Staat und Presse empfindlich gestört.
Klare Linien Was ist verboten
Presseähnliche Inhalte und mangelnde Staatsferne
Die Grenzen der zulässigen kommunalen Öffentlichkeitsarbeit werden dann eindeutig überschritten, wenn staatliche Publikationen den Charakter eines Presseerzeugnisses annehmen. Ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2018 hat hier für Klarheit gesorgt und betont, dass Amtsblätter und ähnliche kommunale Veröffentlichungen primär der amtlichen Bekanntmachung dienen müssen. Es ist ihnen ausdrücklich untersagt, sich wie eine klassische Zeitung zu gerieren und über das allgemeine gesellschaftliche Leben, lokale Sportereignisse, kulturelle Veranstaltungen oder das Vereinsleben zu berichten. Solche Inhalte gehören in den Kernbereich der freien Presse, deren Aufgabe es ist, ein vielfältiges und umfassendes Bild des gesellschaftlichen Lebens zu zeichnen. Greift der Staat in diesen Bereich ein, verletzt er das in Artikel 5 des Grundgesetzes verankerte Gebot der Staatsferne der Presse, das eine grundlegende Säule der Demokratie darstellt.
Dieses Prinzip soll sicherstellen, dass der Staat sich nicht selbst zum Herausgeber von Medien macht und dadurch die Meinungsbildung der Bürger beeinflusst oder gar lenkt. Die Gerichte prüfen bei kommunalen Publikationen daher stets sehr genau Kriterien wie Qualität, Umfang, Inhalt und die Gesamtwirkung. Es muss für den Rezipienten jederzeit unmissverständlich erkennbar sein, ob es sich um eine offizielle Information der Verwaltung oder um ein konkurrierendes Medienangebot handelt. Die systematische Veröffentlichung von Inhalten, die traditionell von Lokalzeitungen abgedeckt werden – etwa Berichte über Schützenfeste, Interviews mit lokalen Künstlern oder Porträts von Unternehmen – stellt eine unzulässige Grenzüberschreitung dar. Auch wenn einige Detailfragen, wie die genaue Ausgestaltung von Amtsblättern, noch beim Bundesverfassungsgericht zur endgültigen Klärung liegen, ist die grundsätzliche Leitlinie der Rechtsprechung eindeutig und konsequent.
Politische Meinungsbildung und unzulässiger Wettbewerb
Eine weitere entscheidende rote Linie ist das strikte Neutralitätsgebot, dem staatliches Handeln unterliegt. Kommunale Veröffentlichungen dürfen unter keinen Umständen den Anschein erwecken, politische Meinungen zu verbreiten oder parteiisch zu sein. Beiträge, die wie ein politischer Leitartikel oder ein Kommentar wirken, eine bestimmte politische Position fördern oder gar Wahlkampf für amtierende Amtsträger betreiben, sind unzulässig. Dies gilt insbesondere in Vorwahlzeiten, in denen eine klare Trennung zwischen amtlicher Information und politischer Werbung gewahrt bleiben muss. Die gezielte Ansprache bestimmter Wählergruppen oder die positive Darstellung der eigenen politischen Erfolge in einem redaktionell aufgemachten Format verstößt nicht nur gegen das Neutralitätsgebot, sondern gerät auch schnell in Konflikt mit dem Presse- und Wettbewerbsrecht, da hier öffentliche Mittel für Zwecke eingesetzt werden, die nicht dem Allgemeinwohl dienen.
Ebenso ist es Kommunen untersagt, ihre Medienangebote gezielt so zu gestalten, dass sie die wirtschaftliche Existenz privater lokaler Medienunternehmen gefährden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Stadtportale oder Social-Media-Kanäle eine hohe Frequenz an tagesaktuellen, redaktionell aufbereiteten und kostenlosen Inhalten veröffentlichen, die in direkter Konkurrenz zu den Bezahlangeboten der lokalen Presse stehen. Der Verband Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den strukturellen Risiken für die lokale Pressefreiheit. Wenn der Staat durch subventionierte Angebote den privaten Medienmarkt aushöhlt, schwindet die Vielfalt an Meinungen und Perspektiven. Eine gesunde Demokratie ist jedoch auf eine kritische und unabhängige Presse als „vierte Gewalt“ angewiesen, die das Handeln der Verwaltung kontrolliert und hinterfragt – eine Aufgabe, die ein staatliches Medium per definitionem nicht erfüllen kann.
Eine strategische Neuausrichtung war unumgänglich
Die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und der aktuellen Konflikte hat gezeigt, dass die kommunale Öffentlichkeitsarbeit auf einem schmalen Grat wandelte. Um kostspielige Rechtsstreitigkeiten und politische Kontroversen zu vermeiden, mussten die Kommunen ihre Kommunikationsstrategien konsequent auf Sachlichkeit, Neutralität und einen eindeutigen Aufgabenbezug ausrichten. Der Leitsatz für eine rechtssichere Praxis kristallisierte sich klar heraus: Informieren war die Pflicht, Journalismus zu betreiben war jedoch untersagt. Vor jeder Veröffentlichung musste die entscheidende Frage gestellt werden, ob der Inhalt der reinen Information über kommunale Aufgaben diente oder bereits in den Bereich der allgemeinen Berichterstattung vordrang. Es wurde unerlässlich, meinungsbildende, wertende oder unterhaltende Aufbereitungen zu unterlassen und stattdessen eine klare, als staatlich gekennzeichnete Informationssprache zu pflegen. Insbesondere bei der Einführung neuer digitaler Formate wie Podcasts, Videoreportagen oder thematischen Newslettern ohne direkten amtlichen Bezug hat sich die präventive Einholung juristischen Rats als entscheidender Schritt erwiesen, um das wichtige Gleichgewicht zwischen dem staatlichen Informationsauftrag und der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit der Presse zu wahren.